Buchtipp: Paolo Cognetti: "Gehen, ohne je den Gipfel zu erreichen" - Dezember 2019

© Hartmut Fanger:
Paolo Cognetti: „Gehen, ohne je den Gipfel zu erreichen“, Penguin Verlag, München 2019
Mit Gehen,ohne je den Gipfel zu besteigen knüpft Cognetti inhaltlich an sein erfolgreiches Romandebut Acht Berge(2018) an. Wieder geht es um das Erlebnis der Bergwelt. Diesmal jedoch nicht in Romanform, vielmehr werden wir Zeuge einer Reise des Autors durch den Himalaya, und zwar ganz im Sinne des bewährten buddhistischen Mottos „Der Weg ist das Ziel“. Und dieser Weg führt, gleichwohl in buddhistischer Tradition, nirgendwo hin als zu sich selbst. In der Einsamkeit der entlegensten Regionen der Bergwelt Nepals kommt es ihm dementsprechend nicht darauf an, etwaige Gipfel zu erklimmen oder gar den leuchtenden Kristallberg zu erspähen. So erweist sich besagtes Unternehmen zunehmend als Pilgerreise, auf der dementsprechend das Gehen selbst zur Mission wird. Als Vorbild hierzu diente ihm u.a. das Buch „Auf der Spur des Schneeleoparden“ von Peter Matthiessen (1978), das nach Cognetti heute noch in allen Buchhandlungen Kathmandus erhältlich ist. Nicht nur hat es Cognetti letztlich zu dieser Reise inspiriert, sondern begleitet es ihn überdies auf Schritt und Tritt. Zu allem hin ist er mit fast vierzig Jahren genauso alt wie Matthiessen, als dieser einst seine Reise antrat. Spannend schildert er den Werdegang seines Vorbilds. So hatte sich Matthiessen einst wie Hemingway oder Fitzgerald in Paris niedergelassen, wo er zu den Gründern der legendären Literaturzeitschrift „Paris Review“ gehörte, schließlich zum Umweltschützer avancierte, um sich später, nach umfangreicher Drogenerfahrung, dem Buddhismus zuzuwenden.
Cognettis Weg in Nepal wiederum ist insofern nicht unwesentlich von der Erfahrung meditativer Einsichten und tiefgreifender Erkenntnis geprägt. „Selbst wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ist ein Wildbach der beste Weg, dem man nur folgen kann“, heißt es an einer Stelle. „Er gibt unbeirrbar die Richtung vor, führt bis zu seiner Quelle, und während man zusehen kann, wie er immer klarer wird, spürt man, wie man nicht nur seiner, sondern auch der eigenen Läuterung entgegengeht!“
Dabei trifft er immer wieder auf tibetische Klöster und Mönche, wie zum Beispiel Shey Gompa, für ‚den vierzig Jahre wie in einem Wimpernschlag verflogen’ sind: „(...) ganz ohne Entdeckungen und Erfindungen, Kriege, Revolutionen, Jugendbewegungen, untergegangene Reiche und Ideologien, ganz ohne Musik und Literatur.“ Und immer wieder macht er Entdeckungen, die ihn staunen lassen. So zum Beispiel die größte Ansammlung von Gebetssteinen, die der Autor auf einem Gelände hinter einem Kloster findet, wo er eigentlich einen Friedhof vermutet hatte.
Nicht nur veranschaulicht durch die plastischen Beschreibungen
der Bergwelt, des kargen Landes und der darin nicht selten anzutreffenden schillernden Persönlichkeiten, erzeugen darüber hinaus die mit feinem Pinselstricht geführten, detailgetreuen Zeichnungen Cognettis zugleich eine unmittelbare Nähe zu dem Autor und seinem Kosmos.
Unbedingt empfehlenswert und denjenigen als Lektüre zwischen den Jahren ans Herz gelegt, die nach Sinn, wahrhafter Natur und meditativem Bewusstsein streben.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Penguin Verlag, München 2019
Yavuz Ekinci "Die Tränen des Propheten" - November 2019

© Hartmut Fanger
Prophet mit Herz und Empathie
Yavuz Ekinci: „Die Tränen des Propheten. Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2019. Aus dem Türkischen von Oliver Kontny
Hervorstechendes Merkmal des Ich-Erzählers und Protagonisten Mehdi – seit seiner Begegnung mit Erzengel Gabriel zum Propheten berufen – ist seine Fähigkeit zur Empathie. Zumal angesichts unablässig auf die Erde hereinbrechender Katastrophen. Immer wieder bricht Mehdi in Tränen aus. Sei es, wenn wieder einmal ein Terroranschlag, kriegerische Auseinandersetzungen und Blutvergießen stattgefunden haben, oder er sich mit Hass und Hetze im Internet konfrontiert sieht. Und immer deutlicher zeichnet sich ab: Er würde den Kampf gegen das Böse aufnehmen, stattdessen mit einer Friedensbotschaft aufwarten. Allem voran wiederum ist es der dem Autor eigene Humor, womit es Yavuz Ekinci gelingt, das Ganze trotz eindringlicher Schilderung menschlichen Leids und Elends lesbar zu halten. Und selbst wenn er einmal an der Welt zu verzweifeln droht, ist dies nicht frei von Selbstironie, was nicht zuletzt den Reiz der Lektüre ausmacht:
Was ist nur aus der Welt geworden. Ich muss mich beeilen. Je länger ich zögere, desto mächtiger wird das Böse. Ich habe keine Zeit mehr. Ich bin Prophet. Ich bin doch geschickt worden, um das Himmelreich Gottes auf Erden herabzubringen“, sagte ich vor mich hin und ging in einen Baumarkt ... Leseprobe
Nicht ohne Augenzwinkern seitens des Autors wiederum vernimmt der Leser, dass sich schon zur Zeit von Mehdis Geburt die seltsamsten Dinge ereignet hätten. Wie aus einem Lehrbuch für autobiographisches Schreiben wird dieser Zeitpunkt im Kontext geheimnisvoll, ja mysteriös anmutender historischer Begebenheiten verortet und somit zu einem besonderen Ereignis stilisiert. Ganz nach dem Vorbild Goethes, der in „Dichtung und Wahrheit“ in der besonderen Sternenkonstellation von Sonne, Jupiter und Mars zum Zeitpunkt seiner Geburt um 12 Uhr ein Zeichen sah. Auch hier wieder im feinen selbstironischen Tenor heißt es bei Ekinci, dass in der Geburtsnacht seines Helden ‚geheimnisvolle Dinge überall auf der Welt geschahen’. Der Legende nach sollen Ufos gesehen worden, ein Flugzeug mit einhundertzweiundsechzig Passagieren verschwunden, Decken in Tempeln, Kathedralen und Moscheen eingestürzt, gar ein ‚Haifisch mit zwei Köpfen aufgetaucht sein.
Doch damit nicht genug. Mangelt es Mehdi in seiner Funktion als Prophet zunächst an Durchsetzungs- und Überzeugungskraft, besteht nun seine Aufgabe vornehmlich darin, an sich selbst zu arbeiten, sich zu entwickeln, um seine Botschaft am Ende in die Welt setzen zu können. Köstlich, wenn dies etwa an seinem Kampf mit einem Hühnerauge, dem er mit einem Hausmittel im wahrsten Sinnes des Wortes zu Leibe rückt, beinahe zu scheitern droht.
Betrachten wir wiederum die opulente Büchersammlung Mehdis, wird schnell klar, woher er seine Botschaften nimmt. Dabei geht’s quer Beet durch die Religionen. Sei es der ‚Koran, den er besser kannte als mancher Imam, seien es die Gleichnisse in den Evangelien, die Bibelzitate, mit denen er gern ein Gespräch eröffnet, oder die Thora, der er geradezu verfallen war’ ... Undogmatisch, melancholisch, zugleich heiter, folgen wir den Wegen und Irrwegen des Protagonisten. Und bei all den dabei verhandelten Erkenntnissen aus den großen monotheistischen Welteligionen ein zugleich hoch aktueller wie brisanter Roman. Kurz: Ein Lesespaß mit Tiefgang, wie wir es uns für zwischen den Tagen nur wünschen können.
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag Antje Kunstmann, München 2019
Buchtipp des Monats November 2019

© Hartmut Fanger:
Axel Hacke: „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“, Verlag Antje Kunstmann, München 2019
Der Autor und Kolumnist Axel Hacke wagt sich mit seinem Buch „Wozu wir da sind“ an ein noch immer tabuisiertes Thema: Sein Held Walter Wemut schreibt seit über dreißig Jahren Nachrufe für eine Zeitung – „eine eigene Seite nur für die Toten und für mich.“ Dementsprechend geht es also vornehmlich um den Tod. Diametral dazu das Paradox, als er den Auftrag erhält, über das gelungene Leben einer achtzigjährigen Freundin zu schreiben. Zusehends evident wird, dass sich die scheinbar unversöhnlichen Pole, Tod und Leben, Leben und Tod, nicht voneinander trennen lassen. Nicht von ungefähr von daher auch das Motto seiner Seite: „Die Toten der Woche./That*s life“. Und so steckt in diesem Buch gleichermaßen die Fülle eines prallgefüllten, bunten Lebens. Und Axel Hacke versteht es in dem von ihm versiert eingesetzten Plauderton im Stil seiner Zeitungskolumnen, dem Unausweichlichen eine Sprache zu verleihen. Zugleich vermittelt sich aber auch Daseinsfreude im Zuge der so spannenden wie lesenswerten Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit ein Leben gelingt, ob es überhaupt möglich ist, diesbezüglich vom Scheitern zu reden. Tiefgreifende Reflexionen, gespickt mit Anekdoten und Zitaten bekannter Dichter wie Rilke oder Schriftsteller wie Stephan Zweig und sein „Die Welt von Gestern“ oder George Simenon und dessen Kommissar Maigret, illuster inszeniert. Aber auch Musiker und Bands, wie George Harrison, John Lennon und Yoko Ono sowie Jethro Tull mit ihrem Album „Locomotive Breath“ sind mit von der Partie. Besonders aussagekräftig die Gedanken über Leonard Cohen. Erst nach dessen Tod im November 2016 ist dem Protagonisten dessen Bedeutung anhand der berühmten Zeilen des Liedes „Anthem“ überhaupt bewusst geworden. Bezeichnend die Strophe, in der es um jenen Riss in allem geht. Zum einen Defekt, zum anderen jedoch zugleich die Möglichkeit, dass eben jener Riss dazu angetan sei, Licht freizusetzen. Nach Cohen heißt es seitens des Protagonisten: „Es gebe keine perfekten Lösungen, nirgendwo, schlimmer noch, die Welt sei voller Risse. Aber genau dort dringe das Licht ein, und genau dort liege die Möglichkeit zur Umkehr, zur Reue. In der Konfrontation mit der Kaputtheit der Dinge“. Und vielleicht liegt ja gerade hierin das Geheimnis eines gelungenen Lebens. Dementsprechend auch das Fazit: „Halten Sie Kontakt zur Welt. Überprüfen Sie ab und zu die Drähte dorthin. Lächeln Sie einen Kaktus an! Achten Sie auf die Risse in den Dingen und den Menschen. Seien Sie bereit, falls das Glück Sie aufsuchen möchte. “
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Antje Kunstmann Verlag in München Zum Archiv
Buchtipp Alma Ragusa "Mein Alphabet" - Oktober 2019
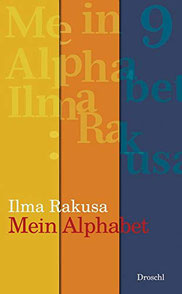
© Erna R. Fanger:
Am Anfang steht das Anderssein
Ilma Rakusa: „Mein Alphabet“, Literaturverlag Droschl GmbH, Graz 2019
A wie „Anders“ steht in diesem poetischen Alphabet nicht nur für den Anfang, sondern scheint zugleich Programm zu sein. Denn das ist eine der ersten Erfahrungen der Autorin als Schulkind, festgehalten in diesem sehr persönlichen Buch: Sie ist anders als ihre Mitschülerinnen. Man zeigt mit dem Finger auf sie, grenzt sie aus. Sie hingegen bleibt „draußen am Zaun“. Dort lernt sie, was wesentlich für ihr späteres Leben als Schriftstellerin sein wird: zu beobachten, in Berührung mit der heilenden Kraft der Natur zu kommen ebenso wie mit ihren Träumen und ihrer Fantasie. Allesamt erweisen sie sich als tragende Kraft durch Schatten und Licht, von der die hier unter besagtem Motto versammelten Kurzprosatexte und Gedichte zeugen.
Tauchen wir ein in die Lektüre, beginnt, jenseits von Hektik und Aufgeregtheit, die derzeit den öffentlichen Diskurs dominieren, eine andere Zeitrechnung. Nämlich die des Kairos, Zeit des Eingedenkens, statt des Kronos‘, des chronologischen, linearen Aspekts der fortschreitenden Zeit. Und eine eigentümliche, ja beinahe schon Sucht erzeugende Ruhe geht von den poetischen Miniaturen des Rakusaschen Kosmos‘ aus, getragen von einer Fülle an Referenzen an Literaturen und ihre Autoren, an bildende Kunst oder die Entdeckung auf Reisen unterschiedlicher Kulturen, an Naturbeobachtungen. Sei es die Erhabenheit ehrfurchtgebietender Berge, sei es die eher ängstigende Wildheit von ‚Atlantik, Pazifik und anderer Ozeane‘ im Gegensatz zum geliebten Mittelmeer der Kindheit in und um Triest.
Und wer einen Zipfel vom Paradies erhaschen will, möge der Lektüre des G wie Granatapfel folgen. Hier liegt die Schönheit besagter Frucht weniger im Auge des Betrachters als vielmehr an der sprachlichen wie faktischen Präzision, mit der Rakusa sie uns nahebringt. Sei es im Hinblick auf die changierende Farbvielfalt, dem Strahlen, „sein Kelchblatt wie ein Krönchen hochreckend“, oder wenn in seinen diversen ,Kammern mit rubinrot leuchtenden Perlen sich ein Schatzkästchen auftut‘. Wobei eine einzelne Frucht bis zu 400 Samen birgt – ‚an ein Wunder grenzend‘. Und wer einmal aus den Augen Rakusas Malewitschs „Schwarzes Quadrat auf weißem Grund« (1915)“ in Augenschein genommen hat, wird, wie Rakusa selbst, eines ‚Erweckungserlebnisses‘ teilhaftig, von dem sie uns wissen lässt: „… es initiierte mich in die gegenstandslose Malerei.“ Wobei die religiöse Diktion kein Zufall ist, vielmehr erfahren wir, dass dieses Schwarz, ‚in seiner Vieldeutigkeit vibrierend, für Malewitsch selbst Ikone war, die er wie ein Heiligenbild in seinem Haus aufhängte‘, wo man seinem ‚dynamischen Schweigen, seinem Rhythmus und seiner Erregung‘ huldigen konnte.
Den Schluss bilden, dem Z gemäß, „Zwetajewa“ und „Zaun“. Marina Zwetajewa (1892-1941), die große russische Dichterin, Dramatikerin und Essayistin. „Fast bin ich mit ihr befreundet, so viele Jahre habe ich mich lesend und übersetzend mit ihr beschäftigt, sie in imaginären Gesprächen um Rat gefragt.“ Schwester im Geiste Rakusas, zugleich Art Spiegelfigur. Zu ihr entfaltet sich allein im Zuge der Herausgabe und Übersetzung ihrer Werke im Suhrkamp Verlag eine so innige Beziehung, dass man die beiden Poetinnen vor dem geistigen Auge zusammen sieht wie zwei eng miteinander vertraute Freundinnen:
»Marina!« Sie schaut mich an. Wachsam. Hinter der Wachsam-
keit erkenne ich tiefe Müdigkeit. Aber es kommt keine Klage. Nur
der Satz, sie müsse noch auf den Markt. »Gehen wir zusammen.«
Last but not least „Zaun“, womit sich der Kreis schließt: „Sie hingegen bleibt „draußen am Zaun“ (siehe oben). Wobei sie zwischen dem poetischen Holzzaun und dem unerbittlichen aus Metall unterscheidet, wo kein Geflüchteter mehr durchkommt. Dem wiederum setzt sie ihr ganz eigenes Plädoyer entgegen: „„Ich plädiere für löchrige Zäune, die symbolisch einhegen. Wie ein zärtlicher Wink. Und dich zum Schauen einladen. Komm, komm …“
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Literaturerlag Droschl in Graz
Siehe auch unseren aktuellen Sachbuchtipp:
Buchtipp Lesley Nneka Anima: Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt - Oktober 2019

© Hartmut Fanger:
Lesley Nneka Arimah „WAS ES BEDEUTET, WENN EIN MANN AUS DEM HIMMEL FÄLLT“. Aus dem Englischen von Zoë Beck, CulturBooks Verlag, Hamburg 2019
"Was eine Erzählung ausmacht,, … dass … Hörer und Leser notwendig so und nicht anders denken können.“
Goethe an K. Streckfuß 27.1.1827
Die Nigerianische, in den USA lebende preisgekrönte Autorin Nneka Arimah versteht ihr Handwerk. Beleg dafür ihr literarisches Debut, der Erzählband mit dem originellen Titel „Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt“. Facettenreich, zugleich ungeschminkt und ungemein realistisch führt sie darin die harten Bedingungen in Nigeria, insbesondere in Lagos und Biafra im Südosten des Landes, vor Augen. Bis heute noch sind die Auswirkungen des Biafra-Kriegs spürbar.Und es bedarf nicht erst, sich der Story „Kriegsgeschichten“ zu widmen, um sich davon ein Bild machen zu können; hier sprechen die Zeilen des Dialogs zwischen der Ich-Erzählerin und deren Vater für sich: „Und was ist dann mit dem Lieutenant passiert?“, fragte ich und wollte eine andere Geschichte hören, die diese auslöschte. „Er starb, Nwando. Sie alle starben.“ „Und wieso bist du nicht gestorben?“ „Weil ich gerannt bin“, sagte er, „als es soweit war.“ Oder in der Titel-Erzählung „Was es bedeutet, wenn ein Mann vom Himmel fällt“, wo am Beispiel Kionis, der Ex-Freundin der Protagonistin, deutlich wird, was der Krieg in den Seelen der Menschen anrichtet: „Mit wie vielen Menschen hatte Kioni im letzten Jahrzehnt gearbeitet? Fünftausend? Zehn ...? Zehntausende Traumata in ihrer Psyche, die aneinander vorbeidrängten und um die Aufmerksamkeit ihres Wirtskörpers wetteiferten. Was würde geschehen, wenn man nicht vergessen könnte (...)“
Immer wieder kommt es zu bösen Überraschungen. So auch in der Geschichte mit dem sarkastischen Titel „Die Zukunft sieht gut aus“, wo die Schwester der von ihrem Mann misshandelten Protagonistin nur schnell deren Sachen abholen will, dabei jedoch von diesem kurzerhand erschossen wird. Oder wenn in „Wild“ eine aufmüpfige Teenagerin – von ihrer Mutter aus den USA nach Nigeria geschickt – dort das Leben ihrer eher angepassten Cousine aufmischt. Nur ein Beispiel für das konfliktive Verhältnis zwischen Mutter und pubertierender Tochter – weiteres zentrales Motiv. Eklatant kommt in ironischer Brechung die Abhängigkeit Letzterer in „Wer erwartet dich zu Hause“ anhand eines alten Liedes zur Sprache. Darin heißt es zum Beispiel: „Wohin gehst du?/ Ich gehe nach Hause//Was erwartet dich zu Hause?/Meine Mutter erwartet mich.//Was wird deine Mutter tun?/Meine Mutter wird mich segnen.//“ Immer wieder ist die Entfremdung zwischen Mutter und Tochter Thema, oft über Kilometer hinweg. Und auch der Tod fungiert hier mitnichten als versöhnender Katalysator. So in „Zweite Chancen“, wo eine Tochter, acht Jahre noch nach dem Tod ihrer Mutter, die konfliktive Beziehung zu dieser in einer Art Endlosschleife so variantenreicher wie unerbittlicher Präsenz immer wieder durchlebt. Wobei die Zahl Acht hier nicht von ungefähr zum Tragen kommt, steht sie doch in der Numerologie sowohl für das Leben nach dem Tod als auch für Unendlichkeit. Erlösendes Moment, wenn die Tochter es schließlich fertig bringt, die Mutter nach endlos anmutenden Kämpfen um Vergebung zu bitten.
Gradlinig und schnörkellos erzählt, dabei kein Wort zu viel, sind die Geschichten Lesley Nneka Arimahs sperrig im besten Sinne, sprich sie widersetzen sich dem Leser und nötigen ihn, den differenzierten Realitäten, wie die Autorin sie entwirft, unvoreingenommen im Text zu folgen. Wobei sie nie ganz preisgeben, was sie zu sagen haben. Vielmehr erfüllen sie, was schon Goethe von Erzählungen erwartete, nämlich, ‚dass Hörer und Leser’ in dem Moment der Lektüre ‚notwendig so und nicht anders denken können’.
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem CulturBooks Verlag in Hamburg
Siehe auch unseren aktuellen Sachbuchtipp:




