Buchtipp des Monats Juni 2021- Juli 2021

© Erna R. Fanger
Jahrzehnt im Grenzgang
Gabriele von Arnim: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, Rowohlt Verlag, Hamburg 2021
„Zehn Jahre lang sitzt die Angst mit am Tisch – oder ihre kleinen Cousinen Unruhe, Sorge, Bangigkeit sitzen neben mir auf dem Sofa, am Schreibtisch, sitzen mit mir am Herd, liegen mit mir im Bett.“ Leseprobe Was bewegt Leser:innen, sich auf die Spuren der intimsten Abgründe eines Schicksals zu begeben, vor dem man innerlich erschaudernd zurückweicht, was Autor:innen, ein solches mit anderen zu teilen, indem sie es öffentlich machen und erzählen. Frage, die an die Grundfeste der Funktion von Literatur rührt. Und gemeinsam scheint Lesenden wie Schreibenden zu sein, dass sie die Absicht hegen, existenzielle Belange zu erhellen, ihnen auf den Grund zu gehen, genau hinzuschauen und für sich selbst mit jedem Buch die Frage neu zu beantworten und zu vertiefen, wie geht das überhaupt, Leben? Im Falle Gabriele von Arnims jüngstem Buch „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“, wie geht Leben an der Grenze dessen, was ein Mensch zu (er)tragen vermag. So, wenn der langjährige Ehemann im Zuge von Herzinfarkt und Schlaganfall in Folge innerhalb kürzester Zeit vom brillant-eloquenten Intellektuellen und Medienmann zum bettlägerigen Pflegefall mutiert. Geistig hellwach, körperlich versehrt, unfähig, sich zu artikulieren, ohne Aussicht auf Besserung, ist er von nun an vollkommen angewiesen auf die Hilfe anderer.
Was es für die Autorin bedeutet hat, sich ein Jahrzehnt lang auf dessen Pflege einzulassen, lässt sie uns, nach dessen Tod dem Appell einer Freundin, „erzähl es“, folgend, mit diesem Buch – Art Lebens- und Sterbensbilanz – wissen. Was diesen Prozess auszeichnet, ist die Genauigkeit, ihre Ehrlichkeit, mit der sie sich an den Grund des Unsagbaren herantastet. Diesem Zustand zwischen Schmerz und Entsagung, zwischen Hoffen, Bangen, Resignation und Verzweiflung. Immer wieder aber auch sind es Glücksmomente, Humor und ihr unabdingbarer Sinn für Ästhetik, die sich als tragkräftig erweisen, tiefgreifender vielleicht, als in augenscheinlich weniger dramatischer Daseinskonstellation. Etwa ‚die betörende Sinnlichkeit eines üppigen Tulpenstraußes mit orangenen, roten oder weißen Blüten. Die Kelche geöffnet …‘ Und nicht zuletzt zeugt dieses Buch von der Kraft der vielen Lektüren, die hier einfließen und sich als Schutzwall erweisen. Als Schutzwall gegen das Bodenlose, dem wir in solcher Lage ausgeliefert scheinen. Da gibt es ‚Vordenker‘ wie der Mexikaner Oktavio Paz, den sie zitiert, der Tod sei für Pariser, New Yorker oder Londoner „ein Wort, das man vermeidet, weil es die Lippen verbrennt“, in Mexiko hingegen heißt es: „Wenn du mich töten willst, dann mit Küssen.“ Und es gibt Weggefährtinnen, wie die gleichfalls vom Verlust ihrer Lieben gezeichnete und darüber schreibende Joan Didion mit ihrem Credo „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben“.
Zu diesen zählt nicht zuletzt die englische Journalistin Elisabeth Tova Bailey, die ein gefährlicher, nicht identifizierbarer Virus über Jahre ans Bett fesselt, wobei ihr eine Schnecke, Mitbringsel einer Freundin auf einer Topfpflanze, zur treuen Begleiterin wird, Trost und Verbundenheit gewährt. Als Schutzwall gegen das Unvermeidliche fungiert gleichwohl der gesamte kulturelle Echoraum, den Kunst jeden Genres uns offeriert, in dem Leiderfahrung in vielfacher Spiegelung seit Jahrtausenden gespeichert und ‚aufgehoben´ scheint. Dies impliziert eine Verbundenheit in der Bewältigung menschlicher Existenz mit Generationen vor uns, aus der wir Trost ziehen und Kraft schöpfen.
Die Schwierigkeit, sich über diese innere Bilanz von Arnims in einer Rezension zu äußern, besteht darin, dass alles, was es darüber zu sagen gibt, wiederum das ausschließt, was man darüber nicht sagt, dem jedoch ebenso viel Bedeutung gebührte. Denn das Leben im Grenzgang übersteigt geläufige Wahrnehmungs- und Deutungsmuster. Als Leser:innen wiederum werden wir Zeuge davon, wie es augenscheinlich eines solch ungeheuren Einschnitts bedurfte, dass die Ich-Erzählerin, unmittelbar vor diesem Zusammenbruch in Begriff, sich von ihrem Mann zu trennen, am Ende über besagtes Jahrzehnt schreibt, „Denn in all diesen elenden Jahren, in denen wir gekämpft, gelitten und gewütet haben, haben wir uns und einander auch mit neuer Innigkeit kennengelernt.“ Leseprobe Eine Freundin beteuert, sie möge ihn seither viel mehr, fühlte sich von ihm ‚ganz anders wahrgenommen‘. Über seine Todesstunde erfahren wir „Zwischen uns Stille, eine sanfte Stille und darin eine überraschende Harmonie, ein Einklang zwischen ihm und mir“Leseprobe, und vom Tod, der ihn dann ereilt hat: „Gekommen in dem Moment zarten Einklangs“ Leseprobe. Solch tröstlich anmutenden Abschied vernehmend, sind wir verlockt zu glauben, das alles habe letztlich seinen tieferen Sinn erfüllt und ein gutes Ende genommen – und hätten damit doch die ganze ungeheure Tragweite des Geschehens verfehlt.
Handelt dies Buch im Kern von Schmerz und Leid, Tod und Vergänglichkeit, überstrahlt schließlich die Lebendigkeit des Erzählens alles, die fluide, sinnliche Bildersprache, angereichert mit Referenzen auf Lektüren, Gedanken, Alltagsbeobachtungen, dem Nachsinnen über Schönheit und Sehnsüchte, Heiterkeit, Melancholie und Zärtlichkeit – am Ende ein Buch über die schiere Fülle des Lebens schlechthin.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Hamburg! Archiv
Buchtipp des Monats Juni 2021
© Hartmut Fanger: „Forever Young“ – zum Achtzigsten von Bob Dylan:
Maik Brüggemeyert (Hrsg.): „Look Out Kid. Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten“, Ullstein Buchverlag GmbH, Berlin 2021

„Look Out Kid“, eine literarische Anthologie zum 80. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers, zugleich Hommage an den Songwriter und Dichter. Wie ein Musik-Album mit „Tracklistening“ durchkomponiert, erzählen zwanzig Autoren, inspiriert von zwanzig Bob Dylan Songs, zwanzig Geschichten auf 271 Seiten. Dabei handelt es sich um so unterschiedliche zeitgenössische Musiker und Schriftsteller, wie Jan Brandt, Judtih Holofernes, Michael Köhlmeier und Benedikt Wells, um nur einige zu nennen. Auffallend, dass es sich dabei vornehmlich um jüngere Autoren handelt, die teils noch nicht einmal auf der Welt waren, als Bob Dylan seinen kometenhaften Aufstieg nahm.
Jeder Autor verbindet natürlich seine eigene Vorstellung mit der Person, der Musik und den Texten des Altmeisters, seine ureigene Geschichte, woraus sich die vorliegende Story-Sammlung letzten Endes speist. Zusammengenommen erfahren wir hier jede Menge Zeitgeist! Plastisch scheinen anhand der Songs von Dylan vor allem die 60er, 70er und 80er Jahre auf. So spielt etwa Tom Kummer auf die Englandtournee Dylans 1966 an, kommen das sagenumwobene (angebliche) Konzert in der Royal Albert Hall und Dylans Griff zur elektrischen Gitarre zur Sprache, womit er sein Publikum schockte. Ebenso wird Dylans eindeutige Positionierung gegen Krieg und Rassismus im Hinblick auf prägende politische Ereignisse transparent. Gleichwohl mit Blick darauf bringt uns wiederum Knarf Rellöm die traurige Erkenntnis nahe, dass der grausame Tod des Schwarzen George Floyd durch einen weißen US-Polizisten aus jüngster Vergangenheit „eine unendliche Zahl von Vorgängern“ hat, was in so manchem Dylan-Song immer wieder Thema gewesen ist. Doch fließen auch die Gegenwart der Pandemie und ihre Auswirkungen hier ein, wie bei Frank Schultz in seiner kunstvoll assoziierten Geschichte zu dem Song „Watching the River Flow“ während eines Ausflugs mit dem Rad an der Elbe.
Fesselnd, dabei rätselhaft, wie es ja auch den Liedern Dylans anhaftet, liest sich „Simple Twist of Fate“ von Marion Brasch, worin sie einzelne Motive des Songs in teils surrealistischer Manier zu einer schillernden Geschichte verwebt. Zugleich spiegelt die Anthologie all das wider, was uns an der Person Bob Dylans über seine Texte hinaus so in den Bann zieht. Und sei es die „Wildlederjacke mit zwei Knopfreihen – so wie Bob Dylan sie auf dem unscharfen Foto von Jerry Schatzberg trägt, das man auf dem Cover seines Album Blonde on Blonde sieht“, wie Maik Brüggemeyer es in „Fourth Time Around“ so schön vor Augen führt. Wie Mode überhaupt nicht unwesentlich das Zeit-Colorit bestimmt, so von Teresa Präuer in „Man in the Long Black Coat“ nahegebracht. Und immer wieder werden Anekdoten erzählt, so bei Polly Roche & Eric Pfeil, wo Bob Dylan in dem Leichenwagen von Neil Young, mit dem er zum Einkaufen fuhr, geschlafen hat.
Darüber hinaus kommt zur Sprache, was Scharen an Dynologen aus den Texten machen, teils streng wissenschaftlich, teils populärphilosophisch und nicht selten kritisch. So verbindet Christiane Rösinger in ihrem Beitrag über „Dont think twice, it’s alright“ das Ganze mit ‚Erbsenzählerei’, wenn es heißt, dass mittlerweile bei Wikipedia selbst die Erwähnung von Hunden in Dylans Werk aufgelistet wird. Dies wiederum gemahnt an den wissenschaftlichen Umgang etwa mit Klassikern wie Goethe, wo in der großen Weimarer Ausgabe mittlerweile jeder Einkaufszettel gesammelt, textkritisch überprüft und mit einem Anhang des Herausgebers publiziert wird.
Doch verweilen wir noch ein wenig bei den Geschichten über die Lieder des Großmeisters und gehen mit Bernadette von Hengst in „Boots of Spanish Leather“ auf US-Tournee, nehmen an der Oscar-Verleihung von Julia Roberts in Stefan Kutzenbergers „Let it be me oder Notting Hill“ teil, bei der illustre Namen wie Hugh Grant, Richard Gere und Sting der Story zusätzlich Glanz verleihen, oder lesen bei Frank Goosen in „It’s alright Ma I’m only bleeding“ von den in den 70er Jahren gängigen Generationen-Kämpfen, all den Vorurteilen der Älteren gegenüber den Jungen mit ihren langen Haaren und ihrer Hippie-Philosophie.
Ein Buch, das einfach Spaß macht, in dem man sich leicht wiederfinden kann und das neben Altbekanntem zahlreiche neue Aspekte zu dem Phänomen Bob Dylan beisteuert. Unbedingt lesenswert!
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! Archiv
Buchtipp des Monats April-Mai 2021
© Erna R. Fanger
Corona-Lockdown – „Pantherzeit“ – Vorboten einer neuen Zukunft
Am 28. Dezember 2020 startete auf NDR Kultur die neunteilige Lesung aus dem noch unveröffentlichten Manuskript von Maria Bodrožić, das diesen Februar unter dem Titel Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge im Otto Müller Verlag, Salzburg, erschienen ist.
Einer muss den langen Atem haben
Warum Pantherzeit. Es war für die heute in Berlin lebende, aus Kroatien stammende Autorin eine Eingebung, die sie traf wie ein Blitz, sie Rilke aus dem Regal ziehen ließ, um sich das berühmte Gedicht noch einmal zu Gemüte zu führen:

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris
Die Relektüre des Gedichts im Kontext der Pandemie beschreibt Bodrožićals ‚starken Moment’, der die folgende Zeit ‚vorweggenommen hätte’, und las es fortan zwei Monate lang mit ihren Nachbar:innen des großen gemeinschaftlichen Wohnprojekts, in dem sie mit Mann und kleiner Tochter lebt, abwechselnd auf dem Balkon. „Durch die Gitterstäbe auf die Welt hinauszusehen, macht die Welt sehr klar und deutlich.“ Im Zuge dessen ist ihr zugleich aber auch bewusst geworden, wie viel Grund sie hat, dankbar zu sein – „das war eine große Erfahrung“. Und haben am Anfang noch viele mitgemacht, war sie zum Schluss mit ihrem Mann allein, es weiterhin allabendlich zu rezitieren: „Einer muss den langen Atem haben und etwas durchschreiten.“
Vom Innenmaß der Dinge
Anknüpfend an die Vorstellung der spanischen Nonne Teresa von Avila (1515-1582), dass die menschliche Seele einer inneren Burg mit vielen Zimmern entspräche, habe sie „diese Zimmer schreibend abgeklopft“. Darunter ‚das Zimmer der Schmerzen, das der Biografie, der eigenen Verfasstheit genauso wie das Zimmer der äußeren Welt, etwa der Ökonomie, des Kapitals, aber auch das Zimmer der inneren und der äußeren Zeit’, um nur einige hier festzuhalten. Und wie von vielen zu vernehmen, erlebt sie den ersten Lockdown als ‚ganz großen Spiegel’ und Brennglas zugleich, in dem Abgründigkeit und Unvermögen menschlichen Verhaltens umso schärfer zutage treten. Zwingend macht es deutlich, wie grundlegend es zu hinterfragen ist. Eben dies tut Bodrožić im Zuge ihrer poetischen Bestandsaufnahme, einer Art Introspektion über den Zustand der Welt.
Was wir verpassen, wenn wir das Alte zurückersehnen
Angesichts gerade jetzt des Entstehens der Möglichkeit einer neuen Zukunft wird Bodrožićumso mehr bewusst, was sie nicht will, nämlich „dass die alte Mentalität der Ellenbogen und Gleichgültigkeit zurückkehrt“. Mehr als das Neue ängstigt sie das Alte. Ebenso wie allein der Gedanke daran, dass nach dem Lockdown ‚die Autos mit ihrem Krach und Gestank die Stadt wieder an sich reißen und die währenddessen erlebte Stille vergessen machen’, sie mit Trauer erfüllt. Wer nur das sucht, was er kennt, dem ist die Sicht neuer Wirklichkeitsbilder versperrt, eindrucksvoll dokumentiert von dem Begründer des alternativen Nobelpreises Jakob von Uexküll. Der fand, zu Gastbei einem Freund, täglich zum Mittagessen einen irdenen Wasserkrug an seinem Platz vor, den der Diener eines Tages zerbrach und ihm stattdessen eine Glaskaraffe hinstellte. Beim Essen suchte er nach dem Krug, sah die Glaskaraffe nicht. Erst nachdem man ihn ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hatte, war er in der Lage, sie wahrzunehmen. Solange uns alte Denk- und Sehgewohnheiten nicht bewusst sind, hindern Sie uns nicht selten daran, das Neue, das längst in die Welt drängt, in Augenschein zu nehmen. „Vielleicht“, so Bodrožić, „ist der wichtigste Aspekt dabei, dass das, was vor uns erscheint, zunächst geistig ist ..., das uns seelische Fingerkuppen und geistige Sehkraft, Vorauskraft gleichermaßen abverlangt.“ Vorausgesetzt, wir sind offen dafür.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Otto Müller Verlag! Archiv
Buchtipp des Monats April-Mai 2021

© Hartmut Fanger
Wenn sich alles ändert ...
Matthias Jügler: „Die Verlassenen“, Penguin-Verlag, München 2021
Matthias Jügler, 1984 in Halle geboren und Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, zeigt in seinem 169 Seiten und 24 Kapitel umfassenden Roman „Die Verlassenen“, dass er, wie schon in seinem Debut „Raubfischen“ (2015), mit allem Wasser gewaschen in der Lage ist, tiefgreifende Prosa zu verfassen, die, mit leiser Stimme erzählt, dennoch spannend zu lesen ist, zugleich nachdenklich stimmt.
Schwerpunkt diesmal das Geheimnis um das Verschwinden des schriftstellernden Vaters, der seinen Sohn ohne ein Wort verlässt. Erst Jahre später erfährt der nach dem frühen Tod der Mutter bei seiner Großmutter untergebrachte Protagonist und Ich-Erzähler Johannes Köhler, was es damit auf sich hatte. Als nämlich seine Großmutter stirbt, stößt er auf einen Brief seines Vaters, der fortan sein Leben und seinen eigenen Blick darauf von Grund auf verändert.
Anrührend die Erinnerungen an den Vater, der als Schriftsteller in dem totalitären System der DDR ins Visier der Stasi gerät und deshalb Lesungen allenfalls im mehr oder weniger privaten Kreis abhält. Während seiner Hochzeitsreise fühlt er sich in Rumänen verfolgt. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellen sollte. Verheerend der Moment, wo der heranwachsende Johannes das Manuskript seines Vaters und damit vier Jahre Arbeit vernichtet, ohne zu wissen, was er tut. Anrührend auch, wie der junge Johannes sich von allen verlassen, wie Robinson Crusoe fühlt, einen Schrebergarten renoviert, den Garten wiederherstellt und ein Einsiedlerleben versucht. Unschwer lassen sich hier Referenzen an Ulrich Plenzdorfs Helden Edgar Wibeau von „Die neuen Leiden des jungen W.“ ausmachen, der sich in Rebellion gegen das Kleinbürgertum DDR und aus Liebeskummer gleichfalls im Gartenhaus eines Schrebergarten verschanzt und als Sohn einer Alleinerziehenden Mutter mit dem abwesenden Vater hadert.
Packend die Ausführungen über die Stasiunterlagen aus den Jahren 1981 bis 1988 im zweiten Drittel des Romans, die authentisch die Bespitzelung der einstigen DDR-Bürger mit Hilfe von Beobachtungsberichten des IMS (Inoffizieller Mitarbeiter Sicherheit) und Fotos vor Augen führen. Vom Ich-Erzähler auf der Busfahrt nach Lyngdal in Norwegen eingesehen. Eine Reise, die ihm genügend Distanz ermöglicht, um all das zu verarbeiten, was besagter Brief und die Folgen seiner eigenen Recherche in ihm aufgewühlt haben und wo sich manches anders darstellte, als er selbst es erlebt hat.
Das Ganze im Ton so warmherzig wie präzise, ein lesenswerter Roman, den wir nur empfehlen können.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl.
Unser herzlicher Dank für das Rezensionsexemplar gilt dem Penguin-Verlag!
Buchtipp des Monats Februar-März 2021
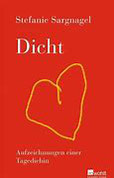
© Erna R. Fanger
Arge Geschichten
Wiener Jugend in den 10er Jahren
Stefanie Sargnagel: "Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin“.Rowohlt Verlag, Hamburg 2020“
Erinnert werden hier „Arge Geschichten“, erlebt zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr, wie seitens Sargnagels im den Aufzeichnungen vorangestellten „Nicht Prolog“ zu vernehmen. Geschichten, die damit beginnen, dass Sarah, die Neue in der Klasse, in das Leben der Ich-Erzählerin tritt. Letztere hat in der Schule keine guten Karten, weder bei den Lehrern, noch bei den Schülern. Besteht sie doch darauf, ‚ihre Gedanken zu äußern, und ist damit so gut wie allein’. In Sarah hingegen ist sie auf eine verlässliche Verbündete gestoßen, mit der gemeinsam sie die leidlichen Schulstunden, wann immer es irgend geht, schwänzt, im Übrigen ‚durch dick und dünn geht’. Abgehängt wird in Parks, Kneipen und Bars. Dort, wo sich all diejenigen einfinden, die nicht mit dem Strom schwimmen. Darunter Künstler und Intellektuelle ebenso wie Gestrandete aller Art, Exzentriker, Junkies, Alkoholiker, Psychos, Bettler ... Eine bunte Crew von Underdogs, die ihrem eigenen Verhaltenscodex folgt, getragen von teils rührender gegenseitiger Fürsorge, zugleich aber auch gepeinigt von Zusammen- und Gewaltausbrüchen. Geprägt von manch spannender Begegnung, erleben die Freundinnen etliche Abenteuer. Im Zentrum die Beziehung zu dem Aids kranken Michi – genialer Kopf, obschon rettungslos verloren, in dessen Wohnung man gleichfalls Zuflucht findet, sich gemeinsam die Zeit vertreibt. „So ein Tag fühlte sich für mich sinnvoller und richtiger an als jeder Schulbesuch. Michi war mein Lehrer und ich seine Auszubildende.“ LeseprobeSchließlich geht es darum, die Welt zu verändern, um Revolution. Auf der letzten Seite das Foto mit dem Porträt eines rauchenden jungen Mannes mit Hut, darunter „Zur Erinnerung an Michi (1963-2014)“. Somit sind die ‚Aufzeichnungen einer Tagediebin’ auch als Erinnerungsbuch an ihn lesbar.
Frappierend die Mischung aus Verlorenheit, Wut, Lebensgier, Überdruss und zärtlichem Miteinander, die diese Gemeinschaft von Außenseitern zusammenhält. In einem jedoch sind sich deren Mitglieder unausgesprochen einig: Der Rahmen des Erfahrungsraums im normierten gesellschaftlichen Miteinander ist eng gesteckt und lässt nur zu, was diesen nicht überschreitet, womit die Möglichkeiten, sich dort mit seinem ungeschmälerten vitalen Potenzial einzubringen, gering sind. Für Freigeister und Künstlerseelen, Exzentriker aller Couleur mit ihrem unverbrauchten Freiheitsdrang und Erlebnishunger eine Art Vorhölle der Langeweile. Was sie wiederum an sozialer Sicherheit, Wohlstand und Prestige einbüßen, gewinnen sie mit Glück an ursprünglicher Echt-Welt-Erfahrung – Gegengewicht zu den vergleichsweise schalen Versprechungen sinnfreien Konsumententums.
Und das Glück ist dem Freundinnenpaar bei all den ‚argen Geschichten’, in die sie nicht selten geraten, schließlich doch immer wieder hold. So etwa auf der Klassenreise durch Irland, wo sie nachts aus dem Fenster ihres Herbergszimmers steigen. Alle Pubs geschlossen, sichten sie auf einem Parkplatz ein Auto mit „drei Typen“. Prompt sprechen die beiden Freundinnen sie an und steigen dann zu den wildfremden jungen Männern, Grafikdesigner aus Lettland und Litauen, ins Auto zu einer Art Spritztour zum Killarney Lake, wo sie mit ihnen paradiesisch anmutende Stunden verbringen, Haschpfeifchen gereicht bekommen:
"Sie pflückten Sarah und mir jeweils ein kleines Blumensträußchen. Der Nachthimmel war voller Sterne, und sie gaben sich alle Mühe, uns zum Lachen zu bringen. Kurz vor eins fuhren sie uns wieder in die Herberge zurück. Sie schenkten uns ihre letzten Zigaretten ... Am nächsten Tag erschien das Ganze wie ein Traum." Leseprobe
Doch nicht jedem in ihrer Clique ist solch’ Glück vergönnt. So mancher unter ihnen hat Pech und kommt in noch jungen Jahren unter die Räder. Wie Michi, dem mit diesem Buch ein berührendes Denkmal gesetzt wurde.
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Hamburg 2020

Dezember 2020 - Januar 2021
© Erna R. Fanger
Virtuos & Wortgewaltig
Gerhard Stadelmaier: „Don Giovanni fährt Taxi. Novelletten",klöpfer.narr, Tübingen 2020
Gleich mit der Widmung zu Beginn „den Klaviergeistern aus Schumanns op. 21, mit Dank auch an Max Frisch, Marina Zwetajewa, William Shakespeare, Lorenzo da Ponte, Patrick Süskind – und alle unerhörten Frauen“, wird hier ein beachtlicher Referenzraum eröffnet. Der von Robert Schumann geprägte Gattungsbegriff verdankt sich im Übrigen dessen Intention, in seinen Klavierstücken „größere zusammenhängende abenteuerliche Geschichten“ zu erzählen, die er dann als Novelletten bezeichnete. Nicht selten hat Schumann diese mit Präambeln versehen, etwa einem Zitat aus Shakespeares Macbeth oder Versen aus Goethes West-östlichem Divan und damit einmal mehr eine Brücke zu Literaturen geschlagen, eine Brücke, die sich hier auch wiederum in umgekehrter Folge Stadelmaier zu eigen gemacht hat, indem er etwa, wie oben zu entnehmen, in sechs „Intermezzi“ von insgesamt 15 Novelletten auf Schumanns ‚Klaviergeister aus Op. 21‘ Bezug nimmt.
Dieser Erzählband des so gefürchteten wie legendären Theaterkritikers, einer der Letzten seiner Zunft in der Tradition eines Alfred Kerr, versammelt hier Geschichten von immenser erzählerischer Wucht und ausgesprochener „Lust am Text“. „Hier steh ich nun, ich kann nicht anders“ – das berühmte Lutherwort möchte man auch Stadelmaier in den Mund legen. Der wiederum kann nicht anders, als die Welt als Bühne zu betrachten. Das Repertoire der Bühnenklassiker hat er sozusagen inhaliert und verwebt die Konflikte seiner Figuren nicht selten mit deren Helden. Schon gleich in der Titel gebenden Geschichte „Don Giovanni fährt Taxi“ fällt dies ins Auge. Dieser Taxifahrer, der seinen Gast zu den Weisen besagter Mozartoper fährt, weiß nicht nur über Oper und Sänger in Ost und West bestens Bescheid, sondern ist auch philosophisch bewandert. Ebenso weiß er, was er nicht (mehr) will und auch sonst Bescheid. So hat er zum Beispiel begriffen, wie schnell man an Dingen festhält, ja dran kleben bleibt. Vor allem an der Liebe. Mit all dem „Schmutz und Schmerz“, den ganzen Scherereien. Nach zwei Ehen Schluss damit. Er kauft sich fortan Liebe, bezahlt dafür. In Art Endlostiraden von martialischer Energie gibt er seine Sicht auf das Leben zum Besten. Vorher ‚Ehedepp im Beziehungsschmutz‘, frönt er jetzt der „Reinheit“, ist „der zärtlichste Mann von der Welt“, kniet auch schon mal vor einer Schönen, innerlich, und zitiert
aus dem Hohelied. Und für ihre Dienste großzügig bezahlend, liegt er „marktwirtschaftlich wie erotisch … hundertfünfzigprozentigrichtig“. Diesem Art Innerem Monolog eines durchgeknallten Taxifahres zu folgen, dabei im Geiste besagten eingeblendeten Opernklängen – der Text in Kursivschrift in Klammern integriert – zu lauschen, ist ein derb-saftiger Lesespaß, der einen unwiderstehlichen Sog ausübt. Und nicht nur bei dieser Geschichte kann man dem Autor nur beipflichten: „Wenn man in der Wirklichkeit die Augen auf macht und die Ohren spitzt vor allem, dann erlebt man seltsame und tolle Dinge.“
Stark in „Intermezzo II: Fürchtenmachen“ (Kinderszene)gleich der erste Satz: „Da vorne steht es und reißt sein schwarzlackiertes Maul auf wie ein gefräßiges Raubtier“ und damit auf den Punkt gebracht, wie die Klavierschülerin sich kurz vor dem Auftritt vor Publikum fühlt. Nämlich wie „Häppchen roher Mensch, ein Häufchen Kind.“ Da mutieren die Tasten zu scharfen Zähnen eines riesen Mauls, in das hinein es seine Finger legen muss. Und das vor Eltern, Geschwistern, Großeltern. Und das kleine Mädchen mit ihrer Bach-Mottete vor dem Ich-Erzähler, zugleich Leidensgenossen an der Reihe, wird dann auch vom Klaviermaul geschnappt und verschlungen. Die Tränen schluckt es hinunter. Nicht so der Ich-Erzähler, der den ersten Akkord aus Schumanns „Kinderszenen“ lediglich anschlägt, bewundernd den Klängen lauscht und dann zum Entsetzen des erwartungsvollen Musiklehrers die Hände im Maul des Untiers ruhen lässt. Die ganze „Kinderszene“ von erfrischender Vitalität, rübergebracht mit Empathie für die kleinen Opfer der Musikpädagogik, denen der Protagonist hier ein echtes Schnippchen geschlagen hat.
Ein Glanzstück an Empathie wiederum ist „Dorf und Depp“. Als Rondo angelegt, dessen Ausgangspunkt der Tod des hier Porträtierten ist, von wo aus dessen Lebensgeschichte aufgerollt wird, eingebettet in die skurril anmutende Dorfgemeinschaft. Auch hier im großen Stil die Ouvertüre, die am Ende auch den Schluss bildet: „Als sie ihn fanden, lag er da wie ein großes Insekt. Das Gesicht gegen den Ackerboden gedrückt. Arme und Beine weit von sich gestreckt. Er hatte sich wohl im Fallen noch abstützen wollen.“ (Leseprobe) Das im Folgenden geschilderte Dorf-Ambiente mutet kafkaesk an. Etwa die Hütte, die zugleich als Vereinsheim, Wirtsstube und Gesellschaftshaus fungiert, gelegen am Rand eines Teichs inmitten von Feldern und umgeben von „kleineren, durch Zäune voneinander getrennten Parzellen … , in denen Ziegen, Schweine, Ponys, Hasen … gehalten wurden.“ (Leseprobe). Gezeugt im Suff von seinen noch jungen Eltern, die wie etliche Dorfbewohnerim Übrigen eng miteinander verwandt sind, hat Dorfdepp Wilhelm, halbblind und nicht ganz richtig im Kopf, sein Geld durch spontane Gesänge verdient. Nicht über fünf Töne hinausgehend, wohnte diesen nichtsdestotrotz oder gerade deshalb eine verführerische Magie nach Art von Schamanen inne, wie er auch stets mit seinem Gesang dort zugegen war, wo jemand das zeitliche segnete.Erzählerischer Höhepunkt ist hier ein Brötchenkauf am Sonntagmorgen, wo zwischen dem Minuten dauernden Hervorbringen seines Anliegens und der endlosen Inanspruchnahme von Zeit, die abgezählten Münzen auf den Zahlteller am Tresen zu legen – indessen hatten sich lange Schlangen gebildet – dies sowohl von der Verkäuferin als auch der Dorfgemeinschaft mit stoischer, dabei freundlich-wohlwollender Geduld hingenommen wird.
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt kloepfer.narr in Tübingen.
Buchtipp des Monats

Buchtipp des Monats
Oktober-November 2020
© Erna R. Fanger
Die Herausforderung der Kunstfreunde
Kristof Magnusson: „Ein Mann der Kunst"Verlag Antje Kunstmann, München 2020
Abgesehen vom Titel, lassen allein die Namensgebung und das Ambiente erahnen, dass den Leser hier eine so feingezeichnete wie süffisante Satire über die Welt der Kunst erwarten dürfte. So, wenn der exzentrische Großkünstler von Weltrang, KD Pratz, auf seiner Burg Ernsteck, hoch über dem Rhein, zurückgezogen residiert. Abgestoßen von der „schlimmen“ Welt, die er indessen ebenso verabscheut wie den Kunstbetrieb, dem er sich von Beginn an seiner Karriere verweigert hat. Aber doch wiederum nicht abgestoßen genug, als dass er, der lange schon jedwedem Besuch den Einlass auf seinem Anwesen verwehrt hat, sich dem nun angekündigten seitens der Mitglieder des Fördervereins des Museums Wendevogel in Frankfurt hätte entziehen können. Immerhin treten sie an, den exklusiv seinem Werk gewidmeten Bau eines Museums finanziell zu unterstützen und auf den Weg zu bringen.
Bemerkenswert die Erzählperspektive, eine gekonnte Mischung aus sicherer Distanz und intimer Nähe aus der Sicht des Ich-Erzählers Constantin Marx. Als Sohn der Vorsitzenden des Fördervereins, Ingeborg Marx – Psychotherapeutin Anfang 70 und glühende Kunstliebhaberin, Feministin auch –, hat er einen privilegierten Zugang zu dem hier versammelten Personal. Seines Zeichens Architekt, momentan in der Warteschleife, erfordern es die Umstände, dass er schon gleich zu Beginn des Romans seine Mutter auf einer entscheidenden Sitzung des Fördervereins zu vertreten hat, um so notgedrungen Einblick in Tücken und Schwerfälligkeit der Bürokratie einer solchen Unternehmung zu gewinnen.
Das Ganze spielt im wesentlichen an einem Sommerwochenende in der Umgebung besagter Burg am Rhein, wo die Mitglieder dem von ihnen so geschätzten wie verehrten KD Pratz erwartungsvoll ihre Aufwartung machen. Kunst ist für sie eine Herausforderung, der sie sich mit leidenschaftlichem Engagement stellen. Das Ambiente geradezu prädestiniert, Kunst und Kultur, Wein und kulinarischen Genüssen zu huldigen. Ausflüge zu entsprechenden Sehenswürdigkeiten ‚nimmt man mit’. Allein, da prallen Welten aufeinander und die nicht immer zu vereinbarenden Beweggründe und Motive der in diesem speziellen Kosmos agierenden Figuren sorgen an diesem Wochenende nicht selten für Zunder – weniger offen ausgetragen als vielmehr subtil vernehmbar, sich zwischen den Zeilen manifestierend. So, wenn den so kunstsinnigen wie beflissenen Mitgliedern des Fördervereins seitens KD Pratz’ mit martialischer Wucht die Unzulänglichkeit des so üblen wie zu verachtenden Weltgetriebes um die Ohren gehauen wird, als wären sie nicht selbst Teil davon, als wären nicht sie es, die hier mit gemeint sind, und gediegener Mittelstand – mal ehrfürchtig, mal zerknirscht, mal verprellt – solche Schelte aber doch über sich ergehen lässt. Entsprechend köchelt und brodelt es, kommt gar zum Eklat.
Bei all dem entlarvt der Autor zwar seine Figuren in den festgefahrenen Rollenklischees, denen sie verhaftet sind, aber er tut dies ohne Häme, stattdessen mit wohlwollender Nachsicht und einem feinen Gespür für die Komik, die Figurenkonstellationen dieser Art mitunter innewohnt.
Lesevergnügen erster Güte bieten die gekonnten Dialoge, wo Muskelspiele, deftiger Schlagaustausch oder aber – besser noch – subtile Spitzen und messescharfe Pfeile das argumentative Hin und Her, Mit- und Gegeneinander dominieren. Zugleich versteht es Magnusson – gleichwohl mittels des Dialogs – seine Figuren als typische Vertreter ihrer Funktion in vorzüglicher Überzeichnung in Erscheinung treten zu lassen. Unterstrichen durch die der Charakterisierung überdies zuträgliche Namensgebung, die, stets witzig, den durchweg satirischen Tenor zusätzlich belebt.
Heiter, klug beobachtet und nicht zuletzt auch nachsichtige Liebeserklärung an die so wunderbare wie zugleich ach so unvollkommene Welt der Kunst mit ihren exzentrischen Akteuren, die einfach Farbe reinbringt und die wir derzeit umso schmerzlicher entbehren. Im gerade düster anmutenden Corona-Herbst insofern unbedingt eine Lektüreempfehlung!
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Antje Kunstmann Verlag!




