Nobelpreis für Literatur 2023 an Jon Fosse
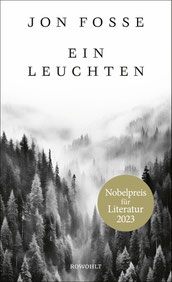
© erf
Angst, Langeweile und leuchtende Leere
Ja, jetzt stehe ich hier, sitze ich hier, dachte ich, und ich fühlte mich leer, als ob die Langeweilezu Leere geworden wäre. Oder eher zu Beklemmung, denn ich fühlte eine Angst in mir, wie ich dasaß und vor mich hin schaute, leer, wie in einem Nichts drin. Jon Fosse
Jon Fosse: Ein Leuchten, Rowohlt Verlag, Hamburg 2023
Jon Fosses jüngster Roman, eine Art Meditation, ist zugleich als Allegorie lesbar für das Ringen des Menschen der Moderne mit seiner Existenz unter den Bedingungen metaphysischer Obdachlosigkeit. Abgekoppelt von der Religion, sprich von der Verbindung zu einer spirituellen Instanz (lat. religio, dt. Rückverbindung), scheint er tief in seinem Inneren auf verlorenem Posten. Sein Leben seit der Aufklärung nahezu ausschließlich nach Prinzipien bestehender Rationalität ausrichtend, beschleicht ihn Langeweile. Hinzu kommt ein Mangel an Verbundenheit, sei es mit der Natur, sei es im sozialen Umfeld. Die Folge – der Mensch der Moderne fühlt sich isoliert, begleitet von Angst und Beklemmung.
Eben dies ist der Ausgangspunkt der Ich-Stimme in Ein Leuchten, wo der Protagonist, aus Langeweile und Überdruss in den Wald fährt und aus diesem, willkürlich mal nach links, mal nach rechts abbiegend, nicht mehr herausfindet. Vergeblich hält er Ausschau nach einem Wendeplatz. Er steigt aus dem Wagen und dringt bei zunehmender Dunkelheit und Kälte immer tiefer in den Wald. Als es obendrein zu schneien beginnt, verliert er, indessen müde und hungrig, vollends die Orientierung, findet auch nicht mehr zu seinem Wagen zurück. Der Protagonist hadert mit sich. Das war bar jeder Vernunft. Es droht ihm die Gefahr zu erfrieren. Wie konnte er nur. Zurückgezogen lebend, würde ihn nicht einmal jemand vermissen.
Doch da sieht er mit einem Mal ein Leuchten, es scheint eine Gestalt zu sein, „wundersam schön anzusehen“ Leseprobe, die sich auf ihn zubewegt. Ist es ein Engel? Ein Gespenst? Als die Gestalt vor ihm steht, geht von dem Leuchten eine Wärme aus. Und dann hat es den Anschein, dass sich erst eine Hand, dann ein Arm um seine Schulter legt, so dass er sich gehalten fühlt, so vage wie zugleich untrennbar mit der Gestalt verbunden. Und er fragt, wer sie sei, und sie antwortet: „Ich bin, der ich bin ...“ Dies kommt dem Ich-Erzähler zwar bekannt vor, aber die Erinnerung an die biblische Geschichte von Moses, der diese Stimme aus dem brennenden Dornbusch gehört hat, scheint ihm fern.
Doch die Gestalt verschwindet mit einem Mal, so wie sie gekommen ist, wird aber auf mysteriöse Weise von einer Vision seiner Eltern abgelöst. Die Mutter tadelt ihn, er solle sich benehmen. Nörgelt an ihm herum, allein in den kalten Wald gegangen zu sein, wo er erfrieren könne. Als ob er noch ein Kind sei. Die Eltern sind alt geworden, dabei hat er sie doch erst gesehen. Vor etlichen Jahren? Oder waren es ein paar Monate, Wochen, Stunden? Wie diese Überlegungen bleibt auch alles andere im Ungewissen, Ungefähren. Protagonist wie Leser sind auf sich selbst zurückgeworfen. Rationale Erwägungen greifen nicht mehr. Damit wird ein Feld eröffnet, in dem die physikalischen Gesetze des materiellen Raums von einer nicht greifbaren metaphysischen Sphäre abgelöst werden, die so etwas wie Trost verheißt. Was im Übrigen auch der Schluss nahelegt – zum einen als Todesvision lesbar, zugleich aber auch als Mahnung, dass der Mensch, getrennt von jeglichem Bewusstsein der Transzendenz, Gefahr läuft, der Verbundenheit zu seiner Seele und damit zur Schöpfung überhaupt wie zu seiner Mitmenschlichkeit verlustig zu gehen.
„ ... und dann bin ich plötzlich in einem Licht drin, so stark, dass es kein Licht ist ... sondern eine Leere, ein Nichts ... und plötzlich gibt es keinen einzigen Atemzug mehr, nur noch die glänzende, schimmernde Gestalt, die in einem atmenden Nichts leuchtet, das jetzt wir atmen, von ihrem Leuchten.“ Leseprobe
Damit tauchen wir tief in die Sphären des Ungewissen, das wir nicht greifen können und das uns doch stets umgibt, man könnte auch sagen –in das Geheimnis des Lebens schlechthin.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag,
Hamburg
Anlässlich der Verleihung des Literatur-Nobelpreises im Oktober 2023 an Jon Fosse haben wir zudem unseren Buchtipp vom März 2022 reaktiviert.

Buchtipp des Monats März-April 2022
© erf
Die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur ein hartnäckiger Eindruck. Albert Einstein
Von innen heraus erzählt
Jon Fosse: Ich ist ein anderer. Heptalogie III-V* Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Rowohlt Verlag, Hamburg 2022
In Ich ist ein anderer erzählt der vielfach ausgezeichnete Theaterautor und Romancier Jon Fosse in Anverwandlung des rimbaudschen Diktums von der Möglichkeit seines Ich-Erzählers Asle, zugleich er selbst sowie ein anderer zu sein. Aber die Identität des Ich-Erzählers schwankt nicht nur zwischen ihm und seinem Alter-Ego, das wie er Maler ist, jedoch im Gegensatz zu ihm erfolglos und dem Alkohol verfallen. Ein gefährdetes Alter-Ego, um das er sich kümmern, dem er beistehen muss. Schwankend ist gleichwohl die Identität des Asle der fiktiven Gegenwart und des Asle in der Erinnerung an das Kind und den Jugendlichen, wo er von sich in der dritten Person erzählt. Nicht zuletzt legt der Name seiner verstorbenen Frau Asel nahe, dass auch sie als Spiegelfigur angelegt ist, indem nur das L, statt hinter dem E, vor dem E platziert werden müsste, und ihr Name und der des Ich-Erzählers wären identisch. Sie ist es auch gewesen, die ihn veranlasst hat, zum Katholizismus zu konvertieren. Letzteres triff im Übrigen nicht nur auf den Ich-Erzähler zu, sondern auch auf den Autor selbst. Und so, wie sich unablässig Identitäten, Subjekt- und Objektebenen verschieben, sich gegenseitig aufzuheben scheinen und dann unverhofft die Richtung wechseln, überlagern sich gleichwohl die unterschiedlichen Zeitebenen. Fiktive Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft fließen übergangslos ineinander, bilden ein bewegtes Kontinuum jenseits der Chronologie der Ereignisse. Daraus erwächst ein Erzählstrom, in dem sich überdies die norwegische Landschaft mit einschreibt, in der der Ich-Erzähler aufgewachsen ist. Weitläufig, spärlich besiedelt – grandiose Kulisse einer mächtigen, verschneiten Bergwelt. Gleichwohl scheint wiederum den Erzähl-Rhythmus – nicht weniger mächtig im Kommen und Gehen seines Wellengangs – das Meer vorzugeben. Raum- und Zeitkontinuum fließen so unablässig ineinander. Die Chronologie der Zeit entbehrt jedweden Ziels, scheint somit aufgehoben. Ereignisse, Betrachtungen erfolgen scheinbar zusammenhanglos nebeneinander, versehen mit Rückgriffen auf Vergangenes, alles auf derselben semantischen Ebene. Desgleichen changieren die sichtbare und die unsichtbare Welt sowie das Diesseits mit seinen realen Figuren, mit denen der Ich-Erzähler in Verbindung steht, wie der Nachbar und Bauer Åsleik oder Galerist Beyer, der regelmäßig seine Bilder ausstellt, und das Jenseits, wo der Ich-Erzähler, umgeben von Engeln, mit seiner verstorbenen Frau im Gespräch ist, die er schmerzlich vermisst. Der Leser wiederum gerät so in den Sog einer Dynamik beredter Stille, in der spürbar die norwegische Landschaft den Erzählfluss mitbestimmt.
Jon Fosse erzählt radikal von innen her, wo eine Vielfalt an Sphären sich beständig kreuzen, sich berühren, um wieder auseinanderzudriften. Wirklichkeit kreiert sich beständig neu, um wieder verworfen zu werden. Die äußere Welt mit ihren politischen und gesellschaftlichen Aporien scheint von diesem radikalen Innenraum des Erzählens mit seinen Wiederholungsstrukturen und gezielt eingesetzten Redundanzen ausgeblendet. Grell im Focus hingegen einzig und allein das Individuum in seiner Vulnerabilität angesichts des Dramas des Menschseins zwischen Geburt und Tod, Schicksal, dem es ohnmächtig ausgeliefert scheint. Der Ich-Erzähler ein alternder Mann, seelisch angeschlagen im Zuge des Verlusts seiner Frau und so konfrontiert mit einer fragilen Existenz, mit der er nicht zurechtkommt. Ein Mensch in seiner Pein, in seiner Not. Ein Mensch in seiner Angst. Nach Heilung fahndend und Heil findend in der Zuflucht zur Religion, in der Zuflucht zum Gebet, woran er zwar zweifelt, was ihm letzten Endes jedoch hilft.
Alles in allem eine komplexe Reflexion über Zeit und Raum, Sein und Identität, Religion, Heil und Heilung. Ein Buch über das Getrenntsein des Menschen von Gott und seine Bestrebungen, über das Medium der Kunst wieder zu einer Einheit mit ihn zu gelangen, ein fortlaufender Erzählfluss ohne Punkt ...
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
*Etwas irritierend, besteht die Heptalogie zwar aus sieben Teilen, die jedoch auf drei Bände verteilt sind, wovon der vorliegende der zweite mit Teil III-V besagter Heptalogie ist.
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Hamburg




